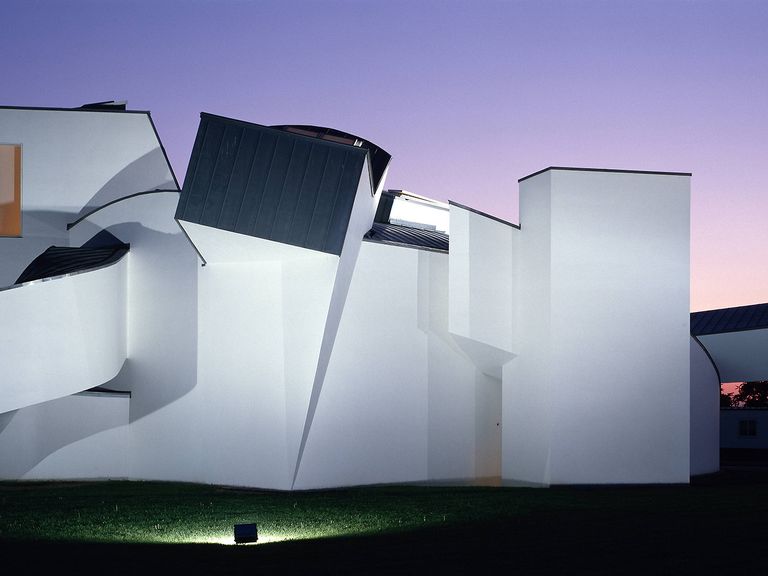7 spektakuläre Diebstähle in Europas Museen

Nach dem aufsehenerregenden Juwelendiebstahl blickt die Welt auf den Pariser Louvre. Am Morgen des 19. Oktober 2025 verschafften sich mehrere als Arbeiter getarnte Täter Zugang zum Gebäude und zur berühmten Galerie d'Apollon. Acht Schmuckstücke mit einem geschätzten Wert von 88 Millionen Euro konnten die bisher unbekannten Diebe erfolgreich entwenden.
Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen werden Kunstmuseen und Galerien nicht selten Ziel von dreisten Raubzügen. Ob organisiert und detailliert geplant oder impulsiv und chaotisch: Die Täter finden dabei immer wieder Lücken in den ausgeklügelten Systemen – und ihre Methoden nicht selten Eingang in Film und Fernsehen. Die folgenden sieben Fälle zeigen einige besonders spektakuläre Diebstähle in Europas Kunstmuseen.
Kunsthalle, Hamburg

Es ist die Nacht auf den 25. Mai 2002, Hamburg feiert die „Lange Nacht der Museen“. Auch die Hamburger Kunsthalle ist dabei, das größte Kunstmuseum der Hansestadt. Hier hängt Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“, außerdem Werke berühmter Impressionisten wie Cézanne, Manet, Monet und Alte Meister wie Rembrandt und Cranach. Von 18 Uhr bis 3 Uhr morgens ist der Kunsttempel geöffnet, 16.000 Menschen streifen durch die Säle.
Irgendwo unter ihnen sind auch die Diebe, denen es gelingt, eine Bronzeskulptur von Alberto Giacometti – geschätzter Wert 500.000 Euro – gegen eine ungenaue hölzerne Kopie auszutauschen. Ihr Vorgehen ist denkbar einfach: Sie heben die unbefestigte Plexiglashaube an, nehmen die Skulptur vom hölzernen Sockel und ersetzen sie durch die Kopie, die dem Original nur entfernt gleicht. Sie rauben das Stück inmitten von Tausenden Kunstinteressierten an einer der wichtigsten Zugangsachsen des Museums. Schmerzliches Detail: Der Austausch fiel erst drei Tage später auf. Bis heute ist die Skulptur verschwunden.
Grünes Gewölbe, Dresden

Es gibt wenige Orte auf der Welt, an denen mehr Kostbarkeiten auf so engem Raum versammelt sind: Das Grüne Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses ist die bekannteste Schatzkammer des Barock, sie birgt Wunderwerke wie den Kirschkern, in den 185 Köpfe geschnitzt sind, oder den größten grünen Diamanten, der je gefunden wurde.
Dass ausgerechnet hier Diebe im November 2019 mit brachialer Dreistigkeit zuschlugen, war ein Schock für die Kunstwelt. Durch ein Fenster stiegen sie in das Gebäude ein und zertrümmerten mit der Axt eine Vitrine im sogenannten Juwelenzimmer. Der Raub dauerte nur wenige Minuten, die Diebe erbeuteten kostbarste Stücke wie die große Brustschleife der Königin Amalie Auguste, besetzt mit 51 großen und 611 kleinen Brillanten oder einen mit Diamanten besetzten Degen.
Die gegründete Soko „Epaulette“ konnte im Zuge ihrer Ermittlungen fünf Verdächtige festnehmen, die im Mai 2023 vom Landgericht Dresden für den Diebstahl verurteilt wurden. Bei einem offiziellen Deal wurde ein Großteil der Beute den Behörden übergeben. Einige elementare Stücke des Schatzes, darunter die große Brustschleife sowie die Epaulette, dem Schulterteil einer Uniform, mit dem berühmten „Sächsischen Weißen“, einem außergewöhnlich reinen Diamanten von fast 50 Karat, sind jedoch bis heute verschollen.
Louvre, Paris

Beim jüngsten Juwelendiebstahl im Louvre handelt es sich längst nicht um den ersten erfolgreichen Raubzug gegen das weltberühmte Pariser Museum. Immer wieder wurde der 1793 eröffnete Louvre in der Vergangenheit Ziel von Kriminellen. Einer der wohl bekanntesten Diebstähle ereignete sich am 21. August 1911, als sich der italienische Handwerker Vincenzo Peruggia über Nacht in einem Schrank versteckte. Das Objekt seiner Begierde war kein Geringeres als das berühmteste Ausstellungsstück des Hauses: Leonardo da Vincis Mona Lisa.
In den frühen Morgenstunden löste er das Gemälde aus seinem Rahmen, nahm es von der Wand und schmuggelte es unbemerkt aus dem Gebäude. Nachdem der Diebstahl – übrigens erst einen Tag später – bemerkt wurde, ließ Frankreich die Grenzen schließen sowie diverse Züge und Schiffe durchsuchen.
Über zwei Jahre lang blieb die Mona Lisa verschwunden, denn Peruggia bewahrte sie in seiner Pariser Wohnung auf. Im Dezember 1913 versuchte er schließlich, das Werk in seiner Heimatstadt Florenz an einen Kunsthändler zu verkaufen, doch dieser alarmierte die Behörden. Am 31. Dezember 1913 kehrte das berühmte Werk in den Louvre zurück.
Musée d'Art Moderne, Paris

Wie ein Hollywood-Film klingt die Geschichte von Vjeran Tomic, der als einer der gerissensten Kunstdiebe der Neuzeit gilt. Ausgerüstet mit Kletterseilen, Karabinerhaken, Gurten sowie Handschuhen mit Saugnäpfen, hangelt er sich im Jahr 2010 Nacht für Nacht am Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris entlang, um dessen Schwachstellen ausfindig zu machen. In der Nacht zum 20. Mai ist es schließlich so weit: Durch ein Fenster gelingt er unbemerkt ins Gebäude, denn das Alarmsystem ist seit Wochen defekt. Insgesamt entwendet Tomic fünf kostbare Meisterwerke, darunter „Le pigeon aux petits pois“ von Pablo Picasso und „La Pastorale“ von Henri Matisse. Besonders sorgfältig geht er dabei nicht vor: Mit einem Messer schneidet der Dieb, der später von Medien als der „Spider-Man von Paris“ betitelt wird, die Kunstwerke aus der Leinwand.
Obwohl Tomic und Komplizen später gefasst und im Jahr 2017 verurteilt wurden, sind die entwendeten Gemälde mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 100 Millionen Euro bis heute verschollen. Einer der verwickelten Hehler behauptete während des Prozesses, er habe die Bilder aus Angst vor der Polizei zerstört in den Müll geworfen. Diese Aussage konnte jedoch nie verifiziert werden.
Munch-Museum, Oslo

Mitten am helllichten Tag stürmen zwei maskierte und bewaffnete Täter im August 2004 das frühere Munch-Museum in Oslo. Unter Androhung von Gewalt reißen sie das ikonische Gemälde „Der Schrei“ sowie das Werk „Madonna“ von der Wand und verlassen den Tatort mit einem bereitstehenden Fluchtfahrzeug. Der aufsehenerregende Raubzug dauert nur wenige Minuten und legt gravierende Sicherheitsmängel des Museums offen.
Erst zwei Jahre späte konnte die norwegische Polizei die beiden Meisterwerke von Edvard Munch bei einer Razzia sicherstellen; die genauen Umstände der Wiederbeschaffung wurden geheim gehalten. Die beiden Haupttäter konnten ermittelt werden, zudem fanden im Rahmen der Ermittlungen weitere Festnahmen statt.
Beide Gemälde befanden sich bei der Übergabe in einem katastrophalen Zustand und mussten aufwendig restauriert werden. Als direkte Folge des Raubes wurde das Munch-Museum für Monate geschlossen und die Sicherheitsvorkehrungen drastisch verschärft, unter anderem durch Metalldetektoren und Panzerglas. 2021 wurde schließlich das neue Munch-Museum direkt am Hafen von Oslo eingeweiht. Das Originalgemälde von „Der Schrei“ aus dem Jahr 1893 befindet sich heute im Nationalmuseum.
Bode-Museum, Berlin

Schon das Objekt an sich hat etwas Absurdes. Eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze mit einem Durchmesser so groß wie ein Autoreifen. Gemacht aus purem Gold, geschätzter Wert: etwa 3,5 Millionen Euro. Ein privater Sammler hatte die Big Maple Leaf 2010 dem Bode-Museum als Leihgabe übergeben, und vielleicht war es gerade dieses massive, schiere Gold, das sie zum Zielobjekt der Diebe machte. Zum Glück, sagen Experten heute, denn: Es wäre womöglich leichter gewesen, kostbarere und handlichere Exponate zu entwenden, Schätze wie Donatellos „Pazzi-Madonna“ oder Mosaik-Ikonen aus dem alten Konstantinopel, für die das Bode-Museum berühmt ist.
So dramatisch der Verlust, so ist die Big Maple Leaf doch zumindest kein historisch bedeutsames Unikat: Fünf dieser Münzen wurden 2007 in Kanada geprägt. Ein Stück solcher Größe und solchen Gewichts zu stehlen, braucht ein gewisses Maß an roher Gewalt: Bei ihrem Raubzug um Jahr 2017 zertrümmerten die Täter das Panzerglas mit einer Axt, sie verluden die Münze auf ein Rollbrett, warfen sie aus dem Fenster und transportierten sie auf einer Schubkarre über die Bahngleise fort. Obwohl die Diebe wenige Monate später gefasst wurden, ist die Münze bis heute verschwunden. Die zuständigen Ermittler gehen davon aus, dass der massive Goldschatz eingeschmolzen und anschließend in kleinen Chargen verkauft wurde.
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

Hilda von Baden war Badens letzte Großherzogin. Sie erlebte zwei Weltkriege und sogar noch die Anfänge der Bundesrepublik, bevor sie 1952 starb. Eine eher introvertierte Frau, zugleich freundlich und engagiert soll sie gewesen sein, bei der Bevölkerung sehr beliebt – und eine große Kunstliebhaberin, die sich gern mit schönen Dingen umgab. Zu ihren kostbarsten Preziosen gehörte ein Diadem mit 367 Brillanten auf einem Rahmen aus Gold und Platin – wahrscheinlich muss man über dieses Schmuckstück in der Vergangenheitsform reden, denn Experten gehen davon aus, dass das auf einen Wert von 1,2 Millionen Euro geschätzte Stück längst in seine Einzelteile zerlegt wurde. Es verschwand 2017 aus einer verschlossenen Vitrine im Thronsaal des Residenzschlosses, wo es als Exponat des Badischen Landesmuseums zu sehen war.
Wie es verschwand, weiß bis heute niemand. Die Scheibe der Vitrine war nicht beschädigt, die Täter wurden niemals ermittelt, das Verfahren ist mittlerweile eingestellt und das Diadem noch immer verschollen. Für das Museum war der Verlust des Diadems ein harter Schlag, aber nicht der erste. Kurz zuvor war im Herbst 2016 bereits ein weiteres Exponat verschwunden: die Elfenbeinskulptur der Römerin Fulvia, die Ciceros abgetrennten Kopf hält. Geschätzter Wert: eine halbe Million Euro.